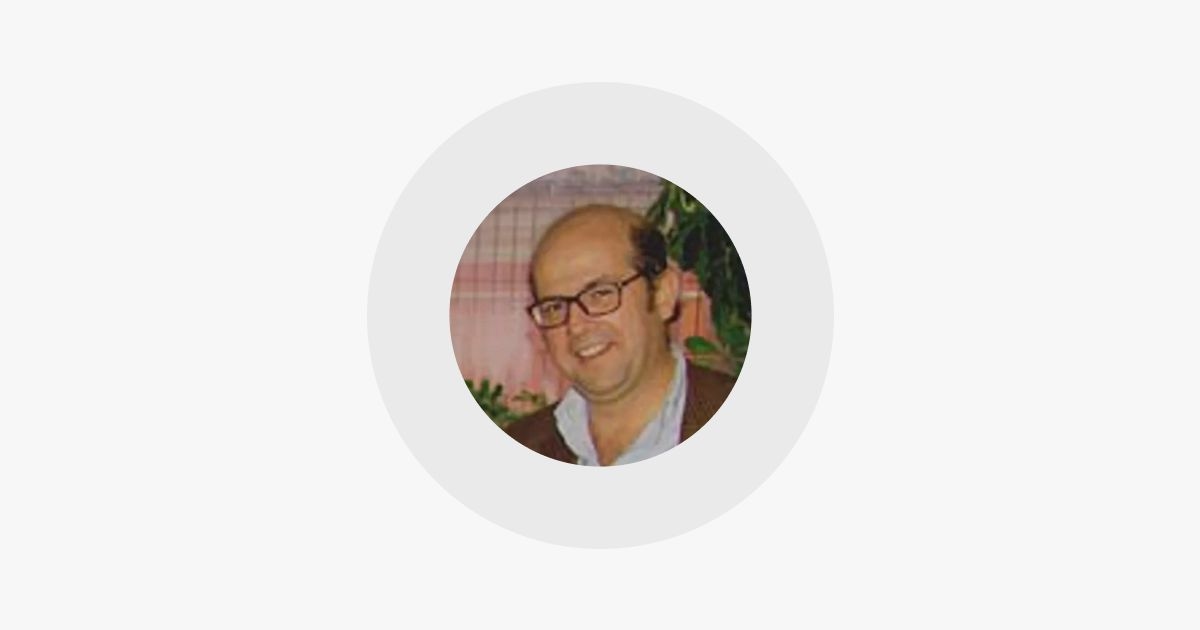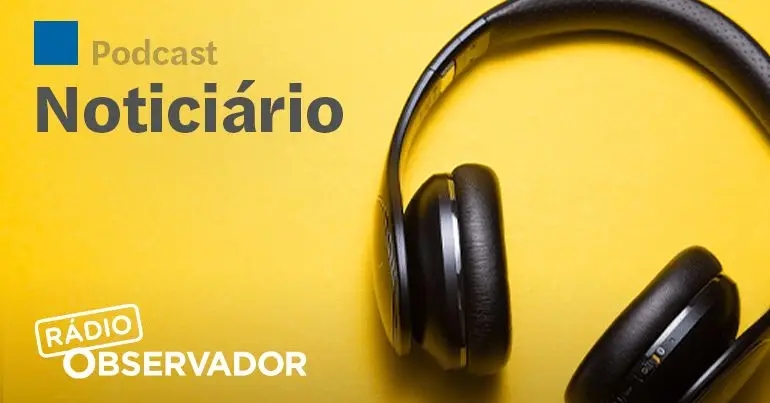Gute Gefühle

Der älteste Trick demokratischer Politik besteht darin, eine unsterbliche Liebe zwischen Politikern und Volk vorzutäuschen. Liebe kann viele Formen annehmen. Politiker, die gewinnen wollen, entdecken, dass der kürzeste Weg zur Macht darin liegt, Liebe für die Menschen, die sie regieren, in Form von Mitgefühl zu zeigen. Dieser Weg ist kürzer, weil er keine Fähigkeiten, Kenntnisse oder Qualifikationen erfordert. Er erfordert vor allem ein gewisses schauspielerisches Talent und ein hohes Maß an Schamlosigkeit.
Die Liebe, die politisch zählt, ist mitfühlende Liebe. Das bedeutet, dass der Politiker die Menschen liebt, weil er oder sie in der Lage ist, mit ihnen zu sympathisieren und ihren Schmerz wirklich zu fühlen. Es versteht sich von selbst, dass die Liebe dieses Politikers für die Menschen scheinbar umso größer ist, je geringer die Liebe anderer Politiker für die leidenden Menschen ist. Da es schwierig ist, die eigene Liebe zu demonstrieren, ist es verlockender, den Kontrast zwischen dem guten Politiker, der mit dem Leid seines Volkes leidet, und dem schlechten Politiker, der „unempfindlich“ für den Schmerz der Menschen ist, aufzuzeigen. Die Alchemie des Erfolgs in der Politik der Emotionen liegt in der Verherrlichung des überragenden Mitgefühls der einen und der ständigen Anschuldigung, dass dies bei anderen nicht der Fall ist.
Wie kann ein Politiker nun zeigen, dass er den Schmerz der Menschen authentischer empfindet als seine Gegner, die mit ihm um die Gunst – um die Liebe – des Volkes konkurrieren? Er muss zeigen, dass er dem Volk näher ist als seine Konkurrenten. Ein „sensibler“ Politiker ist jemand, der „nah“ ist; ein „unsensibler“ ist jemand, der „distanziert“ ist. Im Gegenteil, Distanz zeugt von Unempfindlichkeit und damit von Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen, denn nur durch Nähe können wir ihren Schmerz teilen. Schließlich empfinden wir kein Mitgefühl für reine Abstraktionen. Wir müssen dem konkreten Leid nahe sein. Einem Leid, das wir zumindest sehen können.
Dieser Trick wurde in der relativ langen Geschichte der athenischen Demokratie in der Antike immer wieder angewandt. Meist wurde er von jener eigentümlichen Figur gespielt, die die Griechen den Demagogen nannten. Doch seit der Französischen Revolution ist dieses Spiel noch beständiger und intensiver geworden. Die moderne demokratische Revolution hat die Bühne für Mitgefühl erweitert. Seitdem sind diese „sensiblen“ und schmerzenden Herzen in den Herzen derer zum Vorschein gekommen, die auf der Suche nach Stimmen und Beifall sind – links wie rechts. Insbesondere die politische Linke hat sich auf die Klassentrennung berufen, um „Sensibilität“ noch stärker mit „Nähe“ gleichzusetzen. Die Reichen, die die Reichen repräsentierten, führten ein von den Armen getrenntes und daher distanziertes Leben. Daher konnten sie deren Schmerz nicht kennen und ihr Leid nicht teilen. Reichtum bedeutete im Wesentlichen Distanz zur Realität der überwältigenden Mehrheit der anderen Menschen. Deshalb konnten die Reichen keine guten Herrscher sein. Letztendlich würden sie die guten Menschen verachten und einen unüberwindlichen Klassenhass ausdrücken.
Die moderne Demokratie hat das linke System verwässert. Sie hat die politische Widerlegbarkeit der sozialen Herkunft der vom Volk gewählten Kandidaten auf vielfältige Weise umgangen und so jedem das Spiel der Emotionen ohne große Diskriminierung ermöglicht. Zudem war der Verzicht auf die eigene soziale Herkunft – manche nannten es „Verrat“ –, um von der Gunst des Volkes zu profitieren, schon immer ein bekanntes Beispiel. Reiche und sogar Adlige, die sich in Liebesschwüren für die Armen ergingen und ihre Mitmenschen voller Entsetzen für ihre abscheuliche „Gleichgültigkeit“ und „Gefühllosigkeit“ anprangerten, waren bis vor kurzem noch Chronisten der französischen Revolution und ihrer Nachahmer auf dem ganzen Kontinent.
Die Hypermedialisierung der Politik hat es heute ermöglicht, dass die Techniken dieser Praxis mehrere Ebenen erreichen (oder verschlechtern, je nach Perspektive). Wenn es nur auf die Reinheit dieses Gefühls von Liebe und Mitgefühl ankommt, liegt das Geheimnis darin, es zu zeigen. Da Reinheit unsichtbar ist und sich daher in den Augen der Menschen nicht zeigen lässt, muss die Aufrichtigkeit dieses Gefühls noch bewiesen werden. Aufrichtigkeit ist wiederum schwer zu beweisen, da die Möglichkeit von Heuchelei, Vortäuschung und glatter Lüge stets lauert. Vor Fernseh- und Handybildschirmen ist es daher entscheidend, diese unbestreitbare Aufrichtigkeit durch Gesten und Mimik zu zeigen. Politiker, die weinen oder dem Weinen nahe kommen, mit verschlossenen oder empörten Gesichtern, ähnlich denen der Propheten der Antike, mit Gesten der völligen Identifikation mit dem Leid der Menschen, sind häufig und erfolgreich geworden.
In Portugal gibt es eine lange Reihe sentimentaler Demagogen, die Karriere daraus machten, einen Kontrast zur verunglimpften Hartherzigkeit ihrer Gegner zu fabrizieren. Als Generalsekretär der Sozialistischen Partei und Premierminister war António Guterres vielleicht das peinlichste Beispiel der portugiesischen Demokratie, aber er war nicht der einzige. Innerhalb der Sozialistischen Partei fand er mehrere Nachahmer, mit unterschiedlichem Erfolg. Die anderen Parteien, rechts wie links, folgten schließlich ihrem Beispiel, aus Angst, abgehängt zu werden, gefangen im kalten Käfig der Distanz und „Unempfindlichkeit“. Die Sozialdemokratische Partei (PSD) hatte nicht so viele sentimentale Demagogen in ihren Reihen wie die Sozialistische Partei (PS), und vielleicht hat sie sich deshalb den Ruf einer üblen Partei erworben. Doch auch sie hat einige Kandidaten dieser zweifelhaften Kategorie, die Angst haben, den Zug der sentimentalen Fehlbildung zu verpassen.
Heute jedoch ist es André Ventura, der dieses emotionale Feuerwerk meistern will. Mit akribisch inszenierten Darbietungen täuscht er eine überlegene Nähe zum Schmerz des portugiesischen Volkes vor – im Gegensatz zur grausamen Gleichgültigkeit seiner Gegner, die in einer Blase der Privilegien leben und vor fremdem Leid abgeschirmt sind. Dies wurde im jüngsten Video demonstriert, das in den sozialen Medien von Chega veröffentlicht wurde. Es bestätigt Venturas selbstlosen Heldenmut, nicht durch die Zurschaustellung vermeintlicher persönlicher Überlegenheit, sondern vielmehr durch die Erfahrung der Leidensgemeinschaft mit den von den Bränden dieses Sommers heimgesuchten Menschen, die sich in klar inszenierten und schmerzlich schamlosen Gesten niederschlägt. Dies ist einer jener Fälle, in denen wir uns auf eine konfliktfreie Koexistenz des reinsten Lächerlichen mit wirksamer politischer Überzeugungskraft einstellen müssen.
Paradoxerweise bewirkt der immer tiefere Abstieg ins emotionale Spiel in der Politik das Gegenteil dessen, was ursprünglich beabsichtigt war: die Nähe zwischen Politikern und Regierten zu sichern. Das Gegenteil ist der Fall, denn die Belohnung für technisch inszenierte und medial erfolgreiche Heuchelei ist enorm geworden. Je mehr wir auf „authentischen“ Politikern bestehen, auf solchen, die „aus unserem eigenen“ Umfeld stammen, desto heuchlerischer werden sie. Je mehr wir unmittelbare emotionale Erlebnisse belohnen, desto weniger werden wir als Wähler bereit sein, gut vorbereitete, rollenbewusste und ergebnisorientierte Politiker zu belohnen. Wir leben in einer Zeit, in der sich jeder quält, um morgens und abends ein kurzes emotionales Erlebnis zu haben, am besten beim Starren aufs Handy. Die Politik ist in dieses pausenlose Festival eingedrungen. Doch in diesem Bereich liegt die Messlatte höher. Demokratie ist darauf angewiesen, in der Struktur ihrer öffentlichen Debatte ein Mindestmaß an Rationalität zu bewahren. Von kalter Vernunft. Die Art, die das Herz nicht zum Rasen bringt, sondern dem edelsten Teil unserer Natur entspringt.
In unserer Ära des Reiches der Bilder ist es leicht zu erkennen, wie bestimmte Bilder zu mitunter abrupten politischen Kurswechseln in westlichen Demokratien geführt haben. Wahre oder inszenierte Bilder – Bilder, die uns „beeindrucken“ – erzeugen ein emotionales Erlebnis, das uns automatisch und gedankenlos dazu bringt, eine direkte politische Reaktion zu fordern. Jetzt, da eine neue Ära anbricht, eine Ära der durch neue Technologien geschaffenen Bildervervielfältigung, erodiert die unersetzliche Glaubwürdigkeit des Bildes langsam, und wir haben nichts, was es ersetzen könnte. Zu den bereits erlebten Situationen der Desorientierung kommt ein weiterer hinzu.
observador