Woher weiß unser Gehirn, dass etwas real ist?

Unser Gehirn verbindet Vorstellung und Realität – manchmal zu gut. Wir glauben, jemanden zu sehen oder zu hören. Aber wie können wir sicher sein?
„Wir erschaffen unsere Wahrnehmung der Realität in dem Maße, wie wir sie wahrnehmen.“
Auch wenn Neurowissenschaftler über die Einzelheiten streiten, sind sich die meisten einig, dass es sich bei der Wahrnehmung – also im Wesentlichen darum, wie wir Sinnesinformationen verarbeiten und ein zusammenhängendes Erlebnis schaffen – um die aktive Konstruktion der Realität handelt und nicht um die passive Wahrnehmung der Welt um uns herum, berichtete Popular Science Turkish.
Wenn Sie beispielsweise eine stark befahrene Straße sehen, erschaffen Sie diese Realität aktiv, indem Sie Informationen Ihrer Sinne (die Formen, die Sie sehen, und die Geräusche vorbeirauschender Autos) mit Ihren vergangenen Erfahrungen (dem Wissen, dass Sie diesen berühmten Boulevard schon einmal befahren haben) kombinieren. Das sofortige Erkennen der Realität der vorbeirasenden Autos hilft Ihnen, sicher zu bleiben.
Dieses Modell der Realitätserfahrung ist zwar effizient, aber nicht narrensicher: Unser Gehirn kann Dinge manchmal falsch wahrnehmen. Diese Diskrepanz untersuchte Dijkstra, leitender Forscher am Imagination Reality Lab des University College London, in einer kürzlich in der Zeitschrift Neuron veröffentlichten Arbeit.
Wie hat ein Psychologe zu Beginn des 20. Jahrhunderts unseren Verstand ausgetrickst?Ein Großteil von Dijkstras Arbeiten wurde von der bahnbrechenden Psychologin Mary Cheves West Perky inspiriert. In ihrer bahnbrechenden Arbeit über Vorstellungskraft und Wahrnehmung aus dem Jahr 1910 bat Perky Probanden, sich Objekte – eine rote Tomate, ein grünes Blatt usw. – an einer leeren Wand vorzustellen. In diesen scheinbar leeren Raum projizierte Perky verdeckt kaum sichtbare Bilder derselben Objekte auf die Wand.
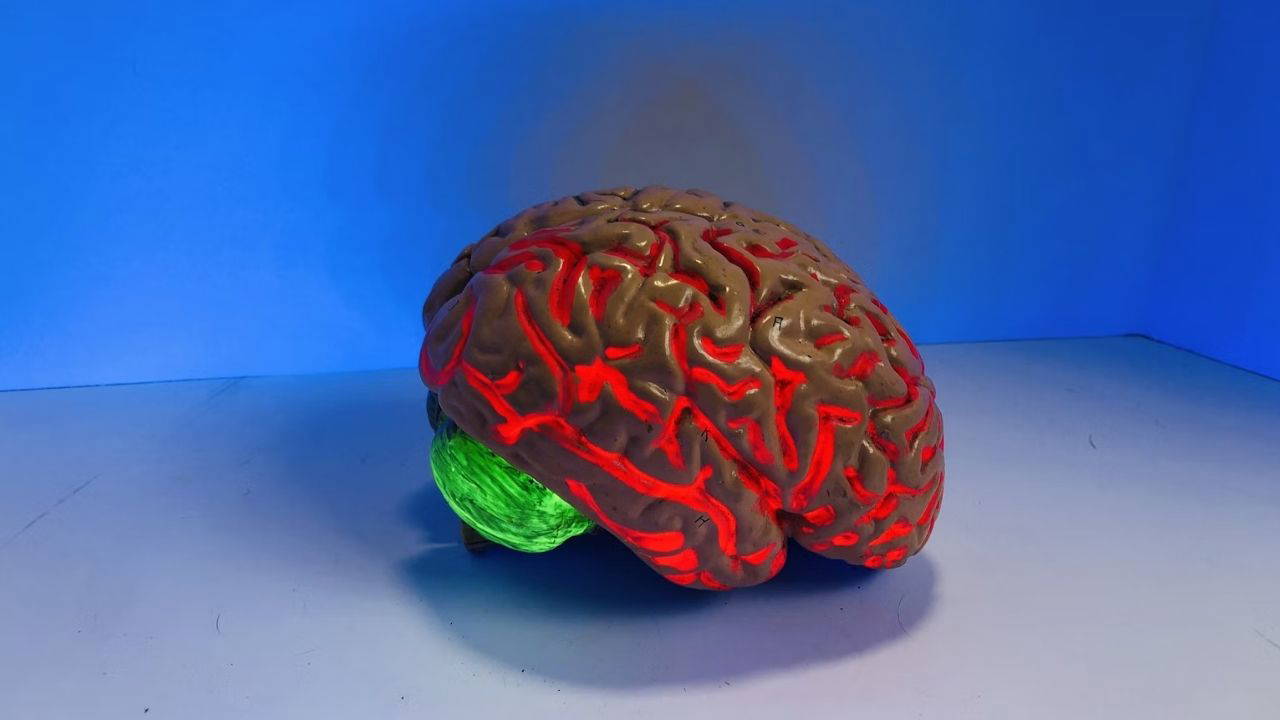
Ohne sich der Situation bewusst zu sein, führten die Probanden die wahrgenommenen Objekte eher auf ihre Vorstellungskraft als auf Projektionen zurück. Laut Perky „muss das Bild der Vorstellungskraft viel mit der Wahrnehmung des Alltags gemeinsam haben.“
Mehr als ein Jahrhundert später glauben viele Forscher, dass Vorstellungskraft und Wahrnehmung zusammenwirken, um unsere Wahrnehmung der Realität zu prägen. Woher also erkennt unser Gehirn, was real ist und was nicht? Dijkstras neue Forschung könnte die Antwort liefern.
Gehirne des 21. Jahrhunderts auf die Probe gestellt„Wir hatten erwartet, dass die Ergebnisse komplexer und differenzierter ausfallen würden“, sagt Djikstra.
Doch Gehirnscans mit funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) verrieten Dijkstra eines klar: Die Aktivität des Grus fusiformis kann Aufschluss darüber geben, ob eine Person ein Bild für real hält. Diese Region, die sich hinter den Schläfen auf beiden Seiten des Gehirns befindet, spielt eine Schlüsselrolle bei der Erkennung von Gesichtern und Objekten. Ihre potenzielle Fähigkeit, zwischen echt und unecht zu unterscheiden, war Neurowissenschaftlern jedoch bisher unbekannt.
Die Studie ähnelt einer modernen Version von Perkys Experiment. Anstatt Früchte und andere Objekte an eine Wand zu projizieren, baten Djikstra und seine Kollegen die Teilnehmer, sich diagonale Linien auf einem Bildschirm vorzustellen. Diese Linien wurden dann durch eine Trennwand in ein fMRT-Gerät projiziert. (Die Verwendung einfacher Formen wie diagonaler Linien erleichtert die Vorhersage, was die Probanden visualisieren könnten. Wenn sie gebeten wurden, sich ein Blatt vorzustellen, visualisierten sie möglicherweise eine große Bandbreite an Formen und Farben.) Diese diagonalen Linien wurden vor einem verrauschten Hintergrund (man denke an ein körniges Fernsehbild) dargestellt, um die Unterscheidung zwischen Realität und Einbildung zu erschweren.

Beim Betrachten realer Linien war die Aktivität im Gyrus fusiformis stärker, als wenn die Teilnehmer wussten, dass sie sich die diagonalen Linien nur einbildeten. Beim Betrachten dieser Linien nahm auch die Aktivität in der vorderen Inselrinde des präfrontalen Kortex zu, einem zentralen Knotenpunkt für die Gehirnnetzwerke im vorderen Teil des Gehirns.
Wenn jedoch jemand die imaginären Linien mit echten verwechselte und tatsächlich eine leichte Halluzination erlebte, wurden sowohl der Spindelgyrus als auch die vordere Inselregion aktiviert, als ob er das echte Ding sehen würde.
Die „Realitätsschwelle“ des GehirnsAus diesen Ergebnissen schlussfolgerten Dijkstra und sein Forschungsteam, dass sich die visualisierten und wahrgenommenen Signale zu einem „Realitätssignal“ verbinden. Ist dieses Signal stark genug, überschreitet es die „Realitätsschwelle“ und wir nehmen wahr, was wir als objektive Realität wahrnehmen.
Dijkstra glaubt zwar, dass die Aktivität im Gyrus fusiformis bestimmt, ob etwas diese Realitätsschwelle überschreitet, doch seine Forschung befinde sich noch in einem frühen Stadium. Er vermutet, dass das Gegenteil der Fall sein könnte und dass die Aktivität im präfrontalen Kortex anhand anderer Signale darüber entscheiden könnte, „ob etwas real ist oder nicht“. Diese Signale gibt er dann an den Gyrus fusiformis zurück, wodurch das Erlebnis verstärkt oder lebendiger wird.
Ein Blick über Gehirnscans hinausWie diese Schwelle überschritten wird, ist wichtig. Der Nachweis eines kausalen Zusammenhangs zwischen Aktivität im Gyrus fusiformis und Halluzinationen könnte es zukünftigen Medizinern ermöglichen, Schizophrenie und andere Hirnerkrankungen durch Stimulation dieses Gehirnteils zu behandeln.
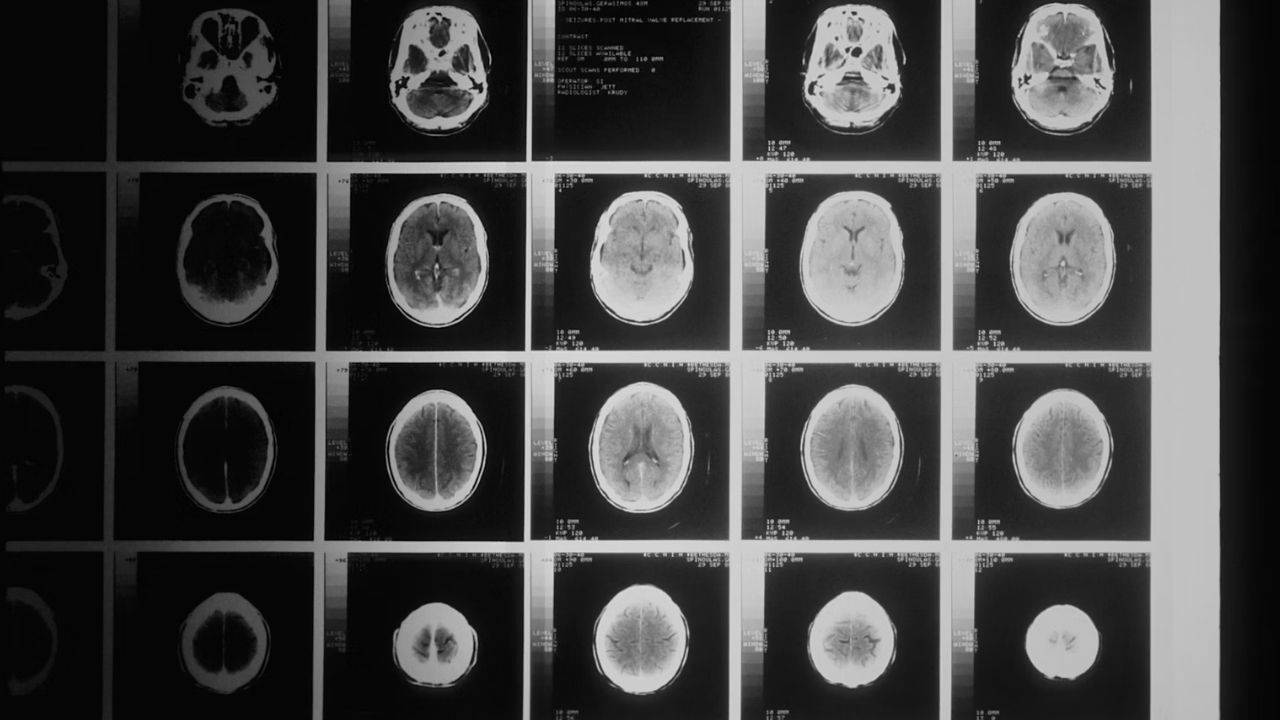
Die Forschung gibt nicht nur Aufschluss darüber, warum Menschen Objekte sehen, die nicht existieren, sondern könnte auch erklären, warum wir manchmal unseren Augen nicht trauen. Als Dijkstra aus den Niederlanden nach London zog, sah er bei einem Spaziergang durch sein Viertel in der Ferne ein Wesen. Obwohl er allein war, hielt er es für einen Hund. „Ich war so schockiert. Ich dachte nur: ‚Wo ist der Besitzer?‘ Ich hatte tatsächlich einen Hund gesehen.“ Hätte er sich nicht umgedreht und die Realität hinterfragt, wäre ihm vielleicht nicht aufgefallen, dass er tatsächlich einen der rund 10.000 Füchse sah, die in seiner neuen Stadt leben. Einen Moment lang spürte Dijkstra etwas, das nicht mit seinen bisherigen Erfahrungen übereinstimmte; er hatte etwas gesehen, das nicht da war.
Was die Zukunft seiner Forschung angeht, sagt Dijkstra, es gebe noch viele unbeantwortete Fragen zur Wahrnehmung, etwa ob Menschen mit lebhafter Vorstellungskraft anfälliger für Halluzinationen seien. In diesem Bereich sei es wichtig, seine eigenen Überzeugungen ständig zu hinterfragen. „Man hat vielleicht eine tolle Idee, die so logisch erscheint und so viel zu erklären scheint, aber dann stellt sich heraus, dass sie völlig falsch ist“, sagt er. „Und das ist okay, denn wir machen immer noch Fortschritte.“
Cumhuriyet





