Der integrale Schleier und die Grenzen des demokratischen Pluralismus.
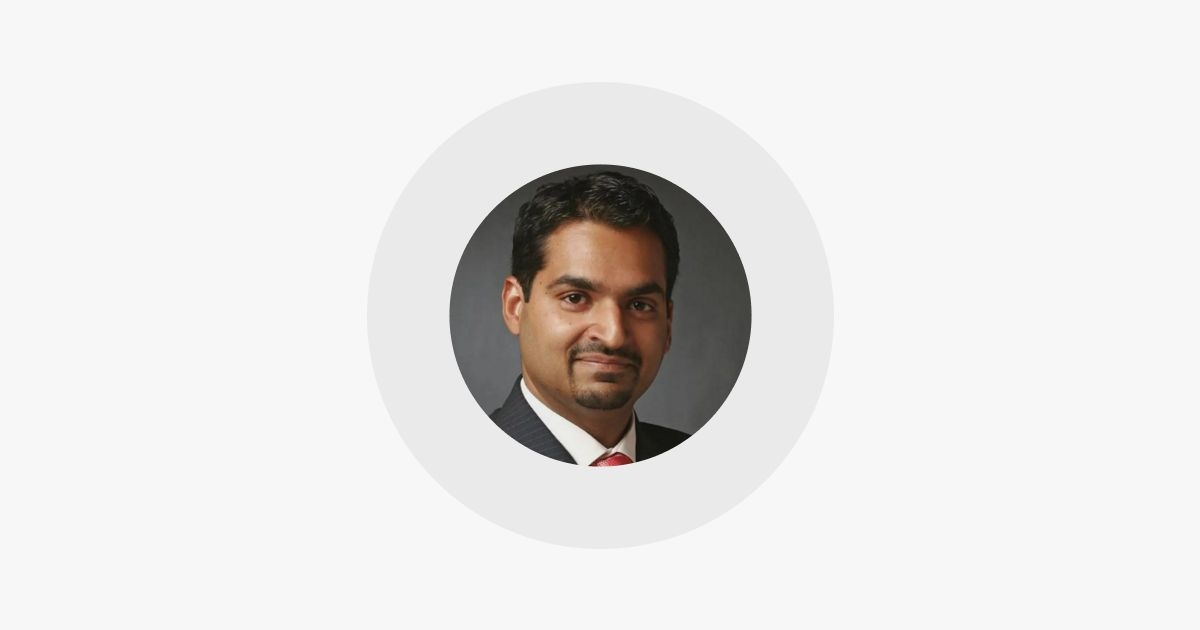
Die Entscheidung des portugiesischen Parlaments, das Tragen von gesichtsverhüllenden Kleidungsstücken wie Burka und Niqab im öffentlichen Raum einzuschränken, hat den üblichen Chor von Anschuldigungen hervorgerufen: Intoleranz, Islamophobie, politischer Opportunismus.
Doch jenseits der Rhetorik steht eine tiefere – und wichtigere – Frage auf dem Spiel: Inwieweit kann und sollte eine demokratische Gesellschaft die kulturellen Grenzen definieren, die ihrem Gemeinwesen zugrunde liegen?
Die eigentliche Debatte dreht sich nicht um Gesichter, sondern um die Regeln des Zusammenlebens – um das Recht einer Gemeinschaft, innerhalb ihrer Traditionen die Art und Weise des „Zusammenlebens“ auszuhandeln.
Die gesamte Gesellschaft beruht auf ungeschriebenen Übereinkünften – einem „stillen Vertrag“, der unser Auftreten und unsere Interaktionen bestimmt. Es handelt sich dabei um über Jahrhunderte gewachsene Gewohnheiten, die die unsichtbare Grammatik des sozialen Lebens bilden.
Da die Einwanderung die europäische Landschaft verändert, wird dieser Vertrag auf die Probe gestellt.
Der Soziologe Christian Joppke beschreibt diese Momente als Bemühungen liberaler Demokratien, ihre Grenzen zu bekräftigen – nicht aus Angst vor dem Fremden, sondern um den inneren Zusammenhalt zu bewahren, der Vielfalt erst ermöglicht. Das neue portugiesische Gesetz sollte in diesem Kontext gelesen werden: nicht als Ablehnung, sondern als Bekräftigung eines gemeinsamen Kodex. Pluralismus ist eine Errungenschaft, aber nicht unendlich. Er beruht auf gemeinsamen Praktiken, die Unterschiede sichtbar machen.
Studien zur „bürgerlichen Integration“ zeigen, dass europäische Demokratien von Neuankömmlingen zunehmend nicht nur die Achtung der Gesetze, sondern auch das Verständnis der den Alltag prägenden Gepflogenheiten fordern. Diese Forderung bedeutet keine Ausgrenzung, sondern Zusammenhalt.
Einer Gesellschaft das Recht abzusprechen, diese Erwartungen selbst zu definieren, bedeutet, den Demokratiegedanken zu untergraben. Eine freie Gemeinschaft muss in der Lage sein, – ruhig und gelassen – zu sagen : So leben wir hier zusammen.
Eine Debatte über „Sichtbarkeit“ würde deren tiefere Dimension verkennen. Die Kernfrage ist kultureller Natur: Wie lässt sich ein Zugehörigkeitsgefühl bewahren, wenn Gewohnheiten und Symbole in Konflikt geraten? Das portugiesische öffentliche Leben – mediterran, beziehungsorientiert, egalitär – schätzt Nähe und Gegenseitigkeit. Das Unbehagen gegenüber dem Vollschleier entspringt nicht religiösem Misstrauen, sondern dem Instinkt, diese soziale Sprache der Begegnung zu schützen.
Auch andere Länder standen vor ähnlichen Dilemmata. Frankreich und Belgien beriefen sich auf das „Zusammenleben“; Österreich und Dänemark schränkten den Schleier im öffentlichen Raum ein; Deutschland und Norwegen beschränkten ihn auf öffentliche Veranstaltungen.
Unterschiedliche Wege, das gleiche Ziel: die Öffentlichkeit als Raum der Begegnung und nicht der Trennung zu bewahren.
Zuwanderung bringt neue Sensibilitäten und Reibungen mit sich – doch dieses Unbehagen ist ein Zeichen demokratischer Vitalität. Der Konflikt richtet sich nicht gegen die Menschen selbst, sondern gegen die Praktiken: dagegen, inwieweit der individuelle Ausdruck vom kollektiven Rhythmus abweichen kann, ohne das Gemeinwesen zu zerstören.
Ich kenne dieses Gleichgewicht aus eigener Erfahrung. Als Immigrant habe ich gelernt, dass Integration Großzügigkeit von beiden Seiten erfordert. Diejenigen, die ankommen, müssen verstehen, dass Willkommenheißen die Akzeptanz der lokalen Gepflogenheiten bedeutet; und diejenigen, die aufgenommen werden, müssen dies tun, ohne dabei ihre eigenen Werte zu verlieren. So wird Pluralismus dauerhaft.
In ganz Europa ist die Debatte um den Schleier zu einer Reflexion über Identität geworden. In Frankreich und Belgien wird der Laizismus bemüht, im Norden Transparenz und staatsbürgerliche Gleichheit; in der Schweiz war das Referendum über die Gesichtsmaske ein Ausdruck von Volkssouveränität.
Portugal bringt sich mit einem eigenen Ton in diese Diskussion ein – gemäßigter, aber im Bewusstsein, dass Vielfalt sichtbare Grenzen erfordert.
Der Philosoph Charles Taylor erinnert uns daran, dass Demokratien auf gemeinsamen „Bedeutungshorizonten“ beruhen. Diese Horizonte verändern sich, aber sie können nicht verschwinden. Wenn wir wollen, dass Vielfalt gedeiht, müssen wir Gesellschaften das Recht einräumen, selbst zu bestimmen, wer sie sind.
In diesem Kontext betrachtet, ist das neue portugiesische Gesetz keine Geste der Ablehnung, sondern eine stille Bekräftigung der eigenen Identität. Gastfreundschaft ist nicht gleichbedeutend mit kultureller Amnesie.
Die Stärke einer Demokratie liegt nicht darin, mit ihrer Selbstdefinition zu zögern, sondern im Mut, dies zu tun, ohne ihre Offenheit zu verlieren. Portugal hat einen Schritt in diese Richtung unternommen: die sozialen Grenzen der Zugehörigkeit in aller Ruhe zu klären.
Das Zusammenleben bleibt die größte Ausübung von Freiheit – und zugleich die anspruchsvollste.
Rahool S. Pai Panandiker ist eingebürgerter Portugiese. Er lebte von 1998 bis 2012 in Portugal und lebt und arbeitet derzeit in Indien. Er promovierte in Chemieingenieurwesen und Erdölraffinerie an der Colorado School of Mines, absolvierte ein Postdoktorat an der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Lissabon und besitzt einen MBA der Katholischen Universität von Portugal. Er ist Mitglied des Portugiesischen Diaspora-Rates.
observador





