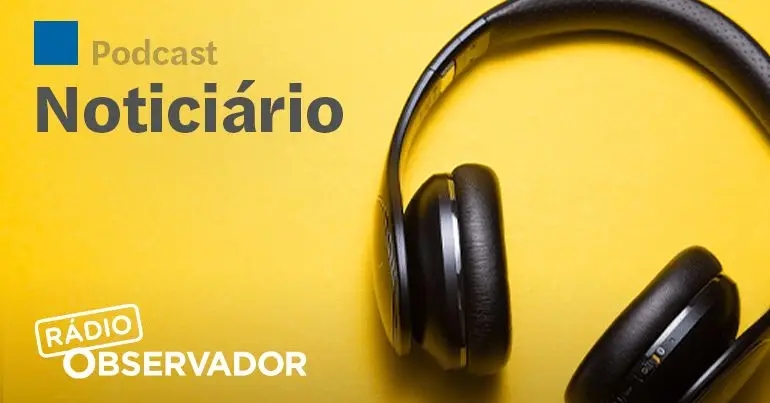Streikrecht versus Streikpflicht

Das Streikrecht ist einer der Grundpfeiler des demokratischen Rechtsstaats und ausdrücklich in der Verfassung der Portugiesischen Republik verankert. Es stellt die Anerkennung der Legitimität der Arbeitnehmer dar, ihre Tätigkeit kollektiv niederzulegen, um Druck auf sie auszuüben und sie zu besseren Arbeitsbedingungen, gerechten Löhnen oder der Einhaltung von Rechten zu drängen. Es handelt sich ohne Zweifel um eine zivilisatorische Errungenschaft. Allerdings gilt dieses Recht wie alle Grundrechte nicht absolut und muss verantwortungsvoll und im Einklang mit den Rechten anderer Bürger ausgeübt werden.
Die große Frage, die sich stellt, lautet: Inwieweit kann ein Streik einer Gruppe im Namen eines legitimen Rechts die Freiheit und die Rechte vieler anderer ernsthaft beeinträchtigen? Wenn die Durchführung eines Streiks wesentliche öffentliche Dienste lahmlegt, den Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung, Mobilität oder die Erfüllung beruflicher Verpflichtungen verhindert, stehen wir vor einem Freiheitskonflikt. „Meine Freiheit endet, wenn ich die Freiheit anderer einschränke“ – eine demokratische Maxime, die in Momenten der Radikalisierung manchmal in Vergessenheit zu geraten scheint.
Es ist nicht legitim, dass unter dem Vorwand eines Streiks der Zugang blockiert wird, Arbeitswillige physisch daran gehindert werden oder ein Klima der Nötigung geschaffen wird. Ich erinnere mich an Beschreibungen der heißen Jahre der PREC (Ongoing Revolutionary Period), in denen der Gewerkschaftskampf mit ideologischer Konfrontation vermischt wurde. Wir hörten Geschichten von Arbeitern, denen der Zutritt zu Fabriken verwehrt wurde, oder von organisiertem Druck zu einem Totalstreik. Wir dachten, diese Praktiken gehörten der Vergangenheit an, doch bestimmte aktuelle Einstellungen zeigen, dass das PREC immer noch, getarnt als neue Ursachen, wieder auftaucht.
Mehr denn je hat eine solche Haltung reale Konsequenzen – und oft laufen sie den Zielen zuwider, die die Streikenden selbst verteidigen. Wenn ein Streik über den Rahmen legitimer Forderungen hinausgeht und zu umfassenden Störungen führt, die die Funktionsfähigkeit wichtiger Dienste oder das Kundenvertrauen nachhaltig beeinträchtigen, entsteht ein Umfeld der Instabilität, das Unternehmen dazu zwingt, ihre Betriebsmodelle zu überdenken. Die Unberechenbarkeit strategischer Sektoren wie Transport, Gesundheit oder Verwaltungsdienste führt zwangsläufig zur Suche nach zuverlässigeren Lösungen, die weniger anfällig für Fluktuationen im Personalbestand sind – und diese Lösung heißt in vielen Fällen Automatisierung. Und viele verstehen den bevorstehenden technologischen Wandel und die Auswirkungen, die er auf die Gesellschaft haben wird, nicht.
Für diejenigen, die Unternehmen leiten oder öffentliche Dienste verwalten, ist der Druck, die Betriebskontinuität und Vorhersehbarkeit für Bürger und Verbraucher sicherzustellen, eine Investition in Technologie, Robotik und künstliche Intelligenz nicht nur wünschenswert, sondern unvermeidlich. Automatisierte Systeme streiken nicht, blockieren keine Zugänge und verlangen keine Gehaltsverhandlungen. Was als Akt des Widerstands beginnt, kann ironischerweise als Katalysator wirken und die Abkehr vom menschlichen Eingreifen in bestimmte Prozesse beschleunigen. Auf diese Weise geraten gerade die Arbeitnehmer, die ihre Rechte wahren wollen, unfreiwillig in eine radikale Position, schaffen das ideale Szenario für ihre Ersetzung, nehmen dem Dialog Raum und schwächen ihre künftige Bedeutung in den Wertschöpfungsketten.
Die Verteidigung des Streikrechts bedeutet den Schutz der Demokratie. Doch die Forderung nach Einhaltung von Pflichten bei der Ausübung dieses Rechts dient der Wahrung seiner Legitimität und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Der Streik darf kein Instrument der Ausgrenzung oder bloßen Konfrontation sein, sondern muss vielmehr eine entschiedene und respektvolle Bestätigung sein. Es geht nicht darum, den Protest zu leugnen, sondern sich daran zu erinnern, dass Freiheit nur dann entsteht, wenn die Freiheit anderer respektiert wird.
Heute brauchen wir mehr denn je eine Kultur des Dialogs, der Verantwortung und der Mäßigung. Denn ohne sie könnte der anfängliche Schrei nach Gerechtigkeit letztlich zu einer Realität führen, in der es keine protestierenden Arbeiter mehr gibt … weil es keine Arbeiter mehr gibt.
observador