Ein Forscher arbeitet an einem Gerät, das Pflanzenkrankheiten am Geruch erkennt.

Jede Pflanze hat ihr eigenes charakteristisches „Duftbouquet“ – flüchtige organische Verbindungen, die sie freisetzt. Die Wissenschaftlerin Dr. Małgorzata Wesoły von der Technischen Universität Warschau arbeitet an einem Gerät, das den Erreger in einer gesammelten Luftprobe „erkennt“, noch bevor sichtbare Symptome auftreten.
„Die meisten von uns kennen wahrscheinlich die Situation: Wir öffneten den Kühlschrank und spürten sofort, dass die Milch verdorben war. Auch wenn wir nicht genau wissen, um welche Verbindung es sich handelt, können wir etwas Charakteristisches riechen. Dieser Gedanke leitet mich bei meinem Projekt. Ich gehe die Analyse ganzheitlich an und konzentriere mich nicht auf die Erkennung einer bestimmten Substanz, sondern erstelle ein sogenanntes flüchtiges Profil des Gemüses – gesund und mit dem Erreger infiziert. Anhand dieses „Geruchsbouquets“ können Infektionen dann im Frühstadium erkannt werden, oft bevor sichtbare Symptome auftreten“, erklärte der Forscher in einem Interview mit PAP.
Ausgangspunkt ist hier die Volatilomik, ein Wissenschaftsgebiet, das flüchtige organische Verbindungen (VOCs) analysiert, die von lebenden Organismen, darunter Menschen, Pflanzen, Mikroorganismen und sogar Krebszellen, abgesondert werden.
Im Rahmen ihres Projekts mit dem Nationalen Wissenschaftszentrum analysiert die Wissenschaftlerin vom Institut für Medizinische Biotechnologie der Fakultät für Chemie der Technischen Universität Warschau Profile flüchtiger organischer Verbindungen, die von Gemüse – hauptsächlich Karotten und Zwiebeln (bei denen Polen der größte Produzent ist) – abgegeben werden, das mit bei diesen Pflanzen häufig auftretenden Krankheiten infiziert ist.
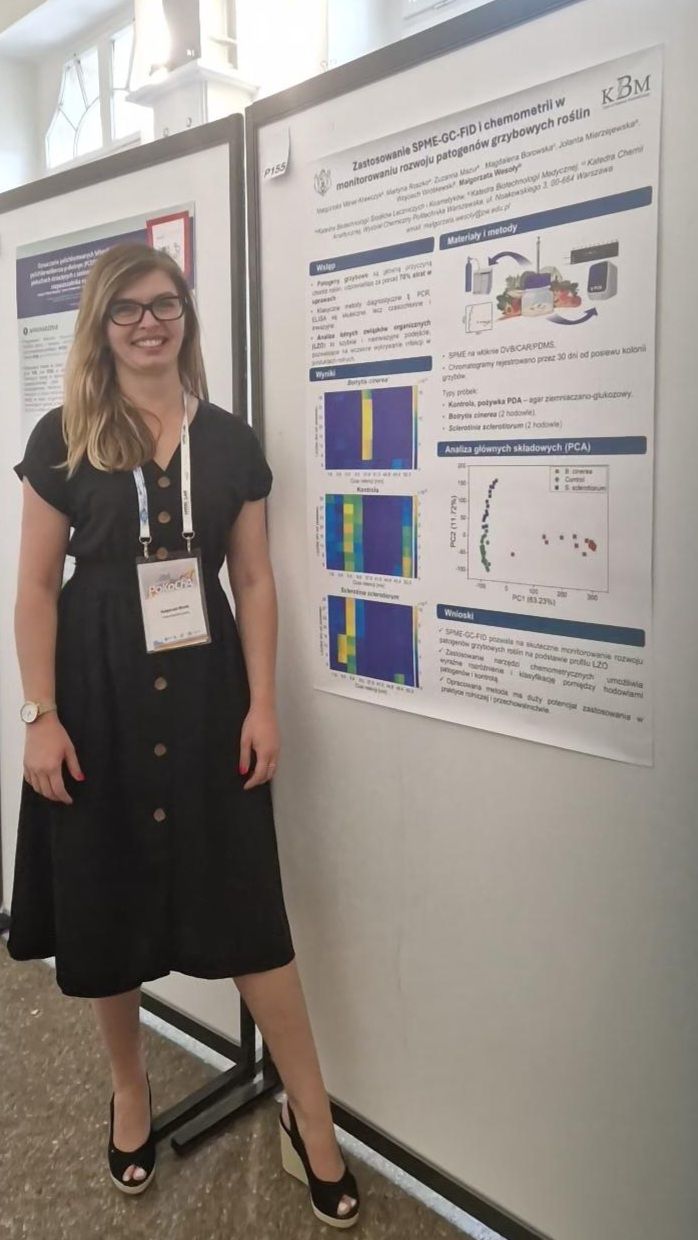
Derzeit sammelt, analysiert, identifiziert und klassifiziert Małgorzata Wesołas Team die von einer verderbenden Karotte in einem Glas freigesetzten Verbindungen. Die Datenanalyse erfolgt mit chemometrischen Methoden, die zur Analyse multidimensionaler Daten eingesetzt werden. So entsteht ein „Geruchsfingerabdruck“ von Karotten – gesund und verderblich.
Die Lösung soll letztendlich in der Landwirtschaft eingesetzt werden. „Schätzungen zufolge sind bis zu 20 % der landwirtschaftlichen Verluste auf Pflanzenkrankheiten zurückzuführen. Wenn es gelänge, ein Tool zu entwickeln, das diese Krankheiten früher erkennt, könnten wir viele Ernten retten“, sagte Małgorzata Wesoły.
Der entwickelte analytische Ansatz soll dazu dienen, Lebensmittel nach der Ernte, die in geschlossenen Räumen gelagert werden, zu überprüfen. „Der einzigartige, charakteristische Geruch, der mit der Infektion einhergeht, tritt früher auf als die sichtbaren Symptome – wenn diese bereits sichtbar sind, bedeutet dies, dass das Gemüse infiziert ist. Meistens wird solches Gemüse oder Obst als Tierfutter verwendet, aber letztendlich entsorgt. So könnte man früher reagieren und beispielsweise die Ernte sortieren oder die Lagerbedingungen ändern“, erklärte sie.
Die Funktionsweise des Geräts selbst scheint einfach: Luft wird aus dem Lagerraum gesammelt, die Probe wird analysiert und mit der Datenbank verglichen.
Wie die Wissenschaftlerin sagte, nutzt sie zur Erkennung von Pflanzenkrankheiten verschiedene Analysewerkzeuge, darunter sowohl Gaschromatographen gekoppelt mit verschiedenen Detektoren als auch eine elektronische Nase.
Laut Małgorzata Wesoła ist die Forschung innovativ, weil sie neue Wege in der Diagnostik von Pflanzenkrankheiten eröffnet. „Traditionelle Diagnosemethoden – z. B. molekulare und serologische – sind oft teuer, zeitaufwendig und im großen Maßstab schwierig anzuwenden. Indem wir die Effektivität der Analyse flüchtiger organischer Verbindungen demonstrieren, wird unser Projekt die Grundlage für eine schnelle und kostengünstige Diagnostik von Pflanzenkrankheiten schaffen“, so Wesoła. (PAP)
Wissenschaft in Polen
akp/ agt/
Die PAP-Stiftung gestattet den kostenlosen Nachdruck von Artikeln aus dem Dienst „Nauka w Polsce“, sofern Sie uns einmal monatlich per E-Mail über die Nutzung des Dienstes informieren und die Quelle des Artikels angeben. In Portalen und Internetdiensten geben Sie bitte die verlinkte Adresse an: Quelle: naukawpolsce.pl, und in Zeitschriften den Vermerk: Quelle: Nauka w Polsce Service – naukawpolsce.pl. Die obige Genehmigung gilt nicht für: Informationen aus der Kategorie „Welt“ sowie jegliches Foto- und Videomaterial.
naukawpolsce.pl





