Studie: Polen mit Migräne richtig diagnostiziert, aber trotzdem schlecht behandelt

In Polen leiden laut einer Studie unter der Leitung von Dr. Marta Waliszewska-Prosół bis zu fünf Millionen Menschen an Migräne , die eine enorme sozioökonomische Belastung darstellt. Obwohl ein relativ hoher Prozentsatz der Patienten schnell und korrekt diagnostiziert wird, lässt ihre Behandlung zu wünschen übrig.
Das Team um Dr. Marta Waliszewska-Prosół, Neurologin an der Medizinischen Universität Breslau, führte die bislang größte nationale Studie zu Migräne mit dem Titel „Migräne in Polen“ durch. Das Ergebnis waren zwei umfangreiche Analysen. Die erste, veröffentlicht im „The Journal of Headache and Pain“ (https://doi.org/10.1186/s10194-023-01575-4), untersuchte Migränesymptome, Komorbiditäten, Lebensqualität und Krankheitslast. Die zweite, veröffentlicht in „Therapeutic Advances in Neurological Disorders“ (https://doi.org/10.1177/17562864251338675), präsentierte Diagnose- und Behandlungsmuster polnischer Patienten und identifizierte deren größte Herausforderungen.
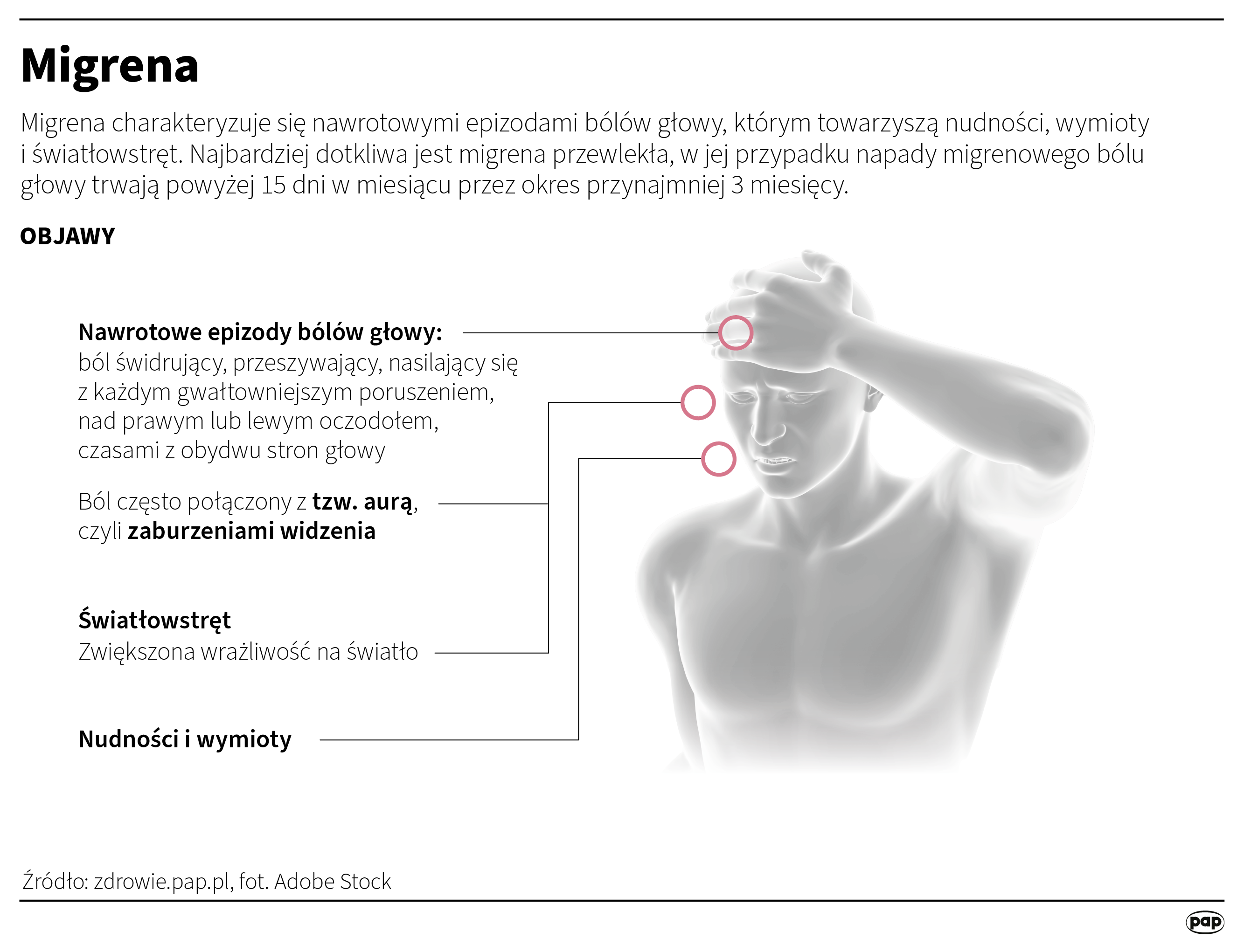
Die Studie wurde als Umfrage durchgeführt. Über 3.200 Personen im Alter von 13 bis 80 Jahren nahmen daran teil, 87 % davon waren Frauen.
Die Ergebnisse zeigten, dass in Polen über vier Millionen Menschen an Migräne leiden. Laut Dr. Waliszewska-Prosół könnte diese Zahl jedoch unterschätzt sein. „Das ist eine enorme Zahl, die das Ausmaß der Krankheit verdeutlicht. Wir haben auch gezeigt, dass die Migränebelastung polnischer Patienten die höchste in ganz Europa ist. Ihre Lebensqualität ist wirklich schlecht“, erklärte die Studienautorin gegenüber PAP.
Die ersten Migräneattacken traten meist im zweiten Lebensjahrzehnt auf, im Durchschnitt mit 19 Jahren. Die Studie ergab jedoch, dass Betroffene den Arztbesuch typischerweise hinauszögern: Die erste Konsultation erfolgt etwa zwei Jahre nach dem ersten Anfall, die formelle Diagnose im Schnitt vier Jahre später. Patienten leiden durchschnittlich 4,7 Tage pro Monat unter Kopfschmerzen, bei fast der Hälfte sogar öfter.
Interessanterweise suchen Polen mit Migräne im Vergleich zu vielen anderen Ländern in Europa und weltweit deutlich häufiger medizinische Hilfe: 93,6 % von ihnen haben aufgrund ihrer Symptome einen Arzt, meist einen Neurologen, aufgesucht. Über 90 % haben eine formelle Migränediagnose erhalten, und 92,5 % nutzen eine Behandlung.
Laut Dr. Waliszewska-Prosół ist dies jedoch nur scheinbar der Fall. Die am häufigsten verwendeten Medikamente sind nichtsteroidale Antirheumatika, Paracetamol und Codein-haltige Medikamente, die bei Migräne unbefriedigend wirken und für diese Erkrankung nicht empfohlen werden. Fast 60 % der Patienten nehmen Codein-haltige Medikamente ein, was ein erhebliches Risiko birgt – sie können zu übermäßigen Kopfschmerzen oder der Entwicklung chronischer Migräne führen. Solche Komplikationen wurden bei bis zu 23 % der Befragten beobachtet. Triptane, die grundlegenden, modernen Medikamente zur Hemmung von Migräneattacken, werden in Polen von 57 % der Patienten eingenommen. Die Autoren der Studie betonten jedoch, dass dies angesichts ihrer hohen Wirksamkeit immer noch ein zu geringer Prozentsatz sei.
Die präventive Behandlung, die die Anzahl der Schmerzattacken reduzieren könnte, ist in Polen besonders unzureichend. Obwohl fast die Hälfte der Studienteilnehmer die Kriterien für eine solche Behandlung erfüllte, nutzten nur 11,5 % sie. Das am häufigsten gewählte Medikament war Iprozochrom – ein in den 1970er Jahren beliebtes Medikament, das in keiner modernen Empfehlung enthalten ist und dessen Wirksamkeit nicht stichhaltig belegt ist. 17 der 18 Personen, denen es verschrieben wurde, setzten die Einnahme ab.
Die Analyse zeigte auch, dass viele Patienten die präventive Behandlung aufgrund mangelnder Ergebnisse, Nebenwirkungen, hoher Kosten oder einfach, weil sie sich besser fühlen, abbrechen – und dies oft ohne Rücksprache mit einem Arzt. Laut dem PAP-Interviewpartner ist dies ein besorgniserregendes Phänomen, da eine zu kurzzeitige Behandlung möglicherweise keine dauerhaften Ergebnisse bringt und ein unkontrollierter Abbruch mit dem Risiko eines Krankheitsrückfalls verbunden ist.
Die Studie zeigte, dass Polen mit Migräne häufig mehrere Fachärzte aufsuchen – nicht nur Neurologen, sondern auch Augenärzte, HNO-Ärzte, Psychiater und Gynäkologen. Laut dem PAP-Interviewpartner könnte dies auf diagnostische Schwierigkeiten zurückzuführen sein, da Migränesymptome verwirrend sein und denen anderer Erkrankungen ähneln können.
„Patienten gehen von Arzt zu Arzt. Oft werden ihre Symptome ignoriert und ihnen wird lediglich geraten, sich auszuruhen und ein vielgepriesenes Schmerzmittel einzunehmen. Meiner Meinung nach mangelt es den Ärzten im Umgang mit Migräne oft an Demut und an Konsens und Zusammenarbeit zwischen den Spezialisten. Viele haben Angst vor dieser Krankheit und trauen sich nicht, sie zu behandeln“, sagte der Neurologe.
Sie stellte fest, dass Migränepatienten in Polen außergewöhnlich häufig Apotheker aufsuchen – 35 % der Befragten suchten ihren Rat. Im Vergleich dazu berichteten in Japan nur 3,6 % der Patienten von einem solchen Kontakt. Dies deutet darauf hin, dass es sinnvoll ist, Apothekenpersonal über die Behandlung dieser Erkrankung aufzuklären, insbesondere im Hinblick auf die riskante Einnahme rezeptfreier Medikamente.
Die Studie ergab außerdem, dass fast drei Viertel der Migränepatienten während eines Anfalls bettlägerig sind und nur 0,4 % normal funktionieren können. Die durchschnittliche Dauer dieser Behinderung beträgt 18,6 Stunden pro Anfall.
Aus diesem Grund haben Migränepatienten erhebliche Schwierigkeiten, am Arbeitsplatz zu funktionieren. In den zwei Wochen vor der Studie waren 330 Personen aufgrund ihrer Erkrankung arbeitsunfähig, und mehr als die Hälfte ging trotz Unwohlsein zur Arbeit. Allerdings erledigten 86 % der Migränepatienten ihre Aufgaben weniger effizient als sonst.
Laut Dr. Waliszewska-Prosół ist die geringe Arbeitseffizienz von Migränepatienten in Polen ein erhebliches Problem. 78 Prozent der Betroffenen geben an, während eines Anfalls die Hälfte der Zeit nicht in der Lage zu sein, ihre Arbeitsaufgaben zu erledigen, fast 80 Prozent arbeiten langsamer und ein Viertel muss aufgrund der Schmerzen seine eigenen Fehler korrigieren.
„Dies zeigt deutlich, dass Präsentismus, also das Bleiben am Arbeitsplatz trotz Krankheit, bei Migränepatienten die Norm ist und gleichzeitig eine enorme Belastung für Arbeitgeber und Wirtschaft darstellt. Entgegen dem Anschein ist ein solches Verhalten lediglich eine Scheinökonomie für das System. Denn selbst wenn jemand zur Arbeit geht, ist seine Produktivität minimal“, stellte der Forscher fest.
Sie erinnerte die Öffentlichkeit daran, dass Migräne nicht nur körperliche Folgen hat. Das in der Studie verwendete Instrument zur Beurteilung der psychischen Gesundheit lieferte alarmierende Ergebnisse: 65,7 % der Migränepatienten zeigten depressive Symptome und über 20 % Angstsymptome.
Zudem endet ein Migräneanfall oft nicht mit dem Abklingen der Schmerzen. Die meisten Menschen brauchen durchschnittlich 16 Stunden, bis sie wieder normal funktionieren, und bei bis zu 83 % der Befragten treten Symptome auf, die einem Anfall vorausgehen. Das bedeutet, dass Migräne die Psyche der Betroffenen nicht nur während des Anfalls selbst, sondern auch davor und danach beeinträchtigt.
Obwohl die Kosten für die Migränebehandlung in Polen teilweise erstattet werden, sind für viele Patienten erhebliche, laufende Kosten damit verbunden. Laut der Studie betrugen die durchschnittlichen monatlichen Behandlungskosten fast 300 PLN, was für einige Befragte über 13 % ihres Monatseinkommens ausmachte.
„Wir müssen den Menschen bewusst machen, dass Migräne eine ernste Krankheit ist, und nicht die Botschaft verbreiten, sie sei hysterisch und ‚einfach in der Natur der Sache‘. Natürlich ist es einfacher, Krankheiten zu erforschen und zu behandeln, deren Auswirkungen sofort sichtbar sind: Krebs, Diabetes usw. Das Hauptsymptom der Migräne ist der Schmerz, der für die Menschen in der Umgebung unsichtbar ist. Aber das soziale Problem ist enorm“, schloss Dr. Waliszewska-Prosół.
Katarzyna Czechowicz (PAP)
kap/ agt/ amac/
naukawpolsce.pl





