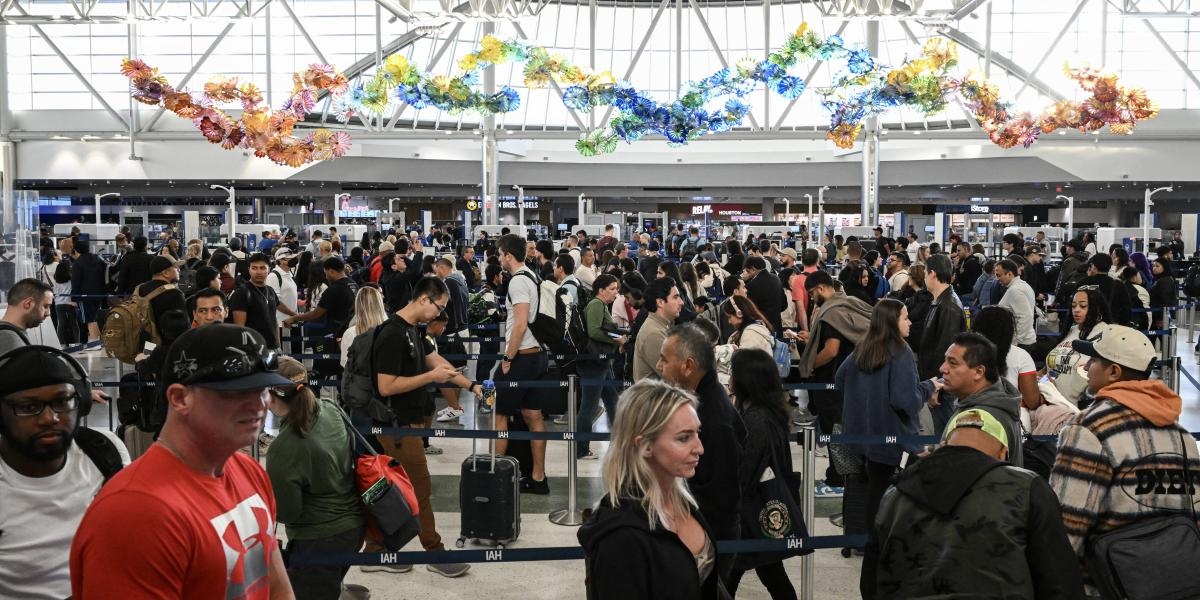Abgesehen vom „Saumindex“ und dem „Lippenstifteffekt“... was sagt der Modekonsum über unsere (persönliche) Ökonomie aus?

Je besser die Wirtschaftslage, desto kürzer die Röcke. Das legt zumindest der Saumindex nahe, eine Theorie, die dem Ökonomen George Taylor zugeschrieben wird, nachdem er das Wachstum der Strumpfwarenindustrie in den Goldenen Zwanzigern in den USA analysiert hatte. Auch der Absatz von rotem Lippenstift soll in Krisenzeiten steigen, da Leonard Lauder, der Präsident von Estée Lauder, beobachtete, dass die Verkäufe dieses Produkts nach der Großen Rezession sprunghaft anstiegen, und dies als „Lippenstift-Effekt “ bezeichnete.
Auch wenn es sich hierbei um informelle Theorien handelt, kann der Konsum verschiedener Produkte Aufschluss über die Finanzlage geben. „Modetrends sind eine Folge der Wirtschaftspolitik, allerdings mit Verzögerung“, sagt Patricia Eguidazu , Expertin für Mode und emotionale Nachhaltigkeit. „Seit zwei Jahren ist Slow Fashion (eine Bewegung hin zu bewussterem, ethischerem und nachhaltigerem Konsum und Produktion) im Trend. Die Kleidungsstücke selbst sind schlichter, qualitativ hochwertiger und bequemer.“ Insbesondere Luxusmarken produzierten Loungewear, was sie als Folge der Pandemie sieht. Tatsächlich analysierte das Ökonometrische Institut der Erasmus School of Economics (Niederlande) die Saumlängen von Kleidern zwischen 1921 und 2009 und kam zu dem Schluss, dass es eine dreijährige Verzögerung gab.
Doch neben den in bestimmten Zeiträumen konsumierten Kleidungsstücken können auch die Konsumgewohnheiten Aufschluss darüber geben, wie wir mit unseren persönlichen Finanzen umgehen. „Es kommt darauf an, wie viel man für Mode ausgibt, insbesondere für unnötige Ausgaben “, betont Eguidazu. „Dies wird durch den Aufstieg von Billigmarken wie Fast-Fashion- Anbietern wie Zara oder Primark begünstigt, die „keine Bedürfnisse befriedigen und Impulskäufe sowie ständiges, unkontrolliertes Ausgeben fördern.“
Die Folgen dieses Verhaltens wirken sich letztendlich auf die finanzielle Situation aus und belasten ohnehin schon knappe Budgets zusätzlich. „Es führt zu immer höheren Ausgaben, die sich letztendlich auf die Ersparnisse und das verfügbare Einkommen auswirken “, so die Autorin des Buches *Der Tag, an dem ich aufhörte, Kleidung zu kaufen *. Anders ausgedrückt: Der Kauf der kürzesten Röcke in angesagten Läden ist kein Zeichen für eine gute finanzielle Lage; er könnte vielmehr ein Warnsignal sein, das Budget zu überprüfen und zu sehen, wie viel nach Abzug aller „kleinen Käufe“ von Kleidung oder Schuhen übrig bleibt.
Aus diesem Grund erklärt Eguidazu, dass es zwei Arten von Modekonsumenten gibt: die Gruppe der Menschen, die Fast Fashion kaufen, meist unbewusst motiviert durch „das Dopamin, das durch das fortgesetzte Kaufen in einer Schleife erzeugt wird“, oder diejenigen, die Qualität suchen und sich mit Mode auseinandersetzen, um Preise zu finden, die die Eigenschaften des Kleidungsstücks kompensieren.
Daher empfiehlt die Expertin, zunächst die eigenen Konsumgewohnheiten im Modebereich zu hinterfragen und räumt ein, dass dies „sehr beängstigend“ sei, aber der erste Schritt zu bewussterem Konsum und dem Verzicht auf Einsparungen bei notwendigen Ausgaben darstelle. Die Analyse der Ursachen für Kaufzwang kann daher oft dazu führen, sich zu fragen, ob die Ausgaben „es wert sind oder nicht“.
elmundo