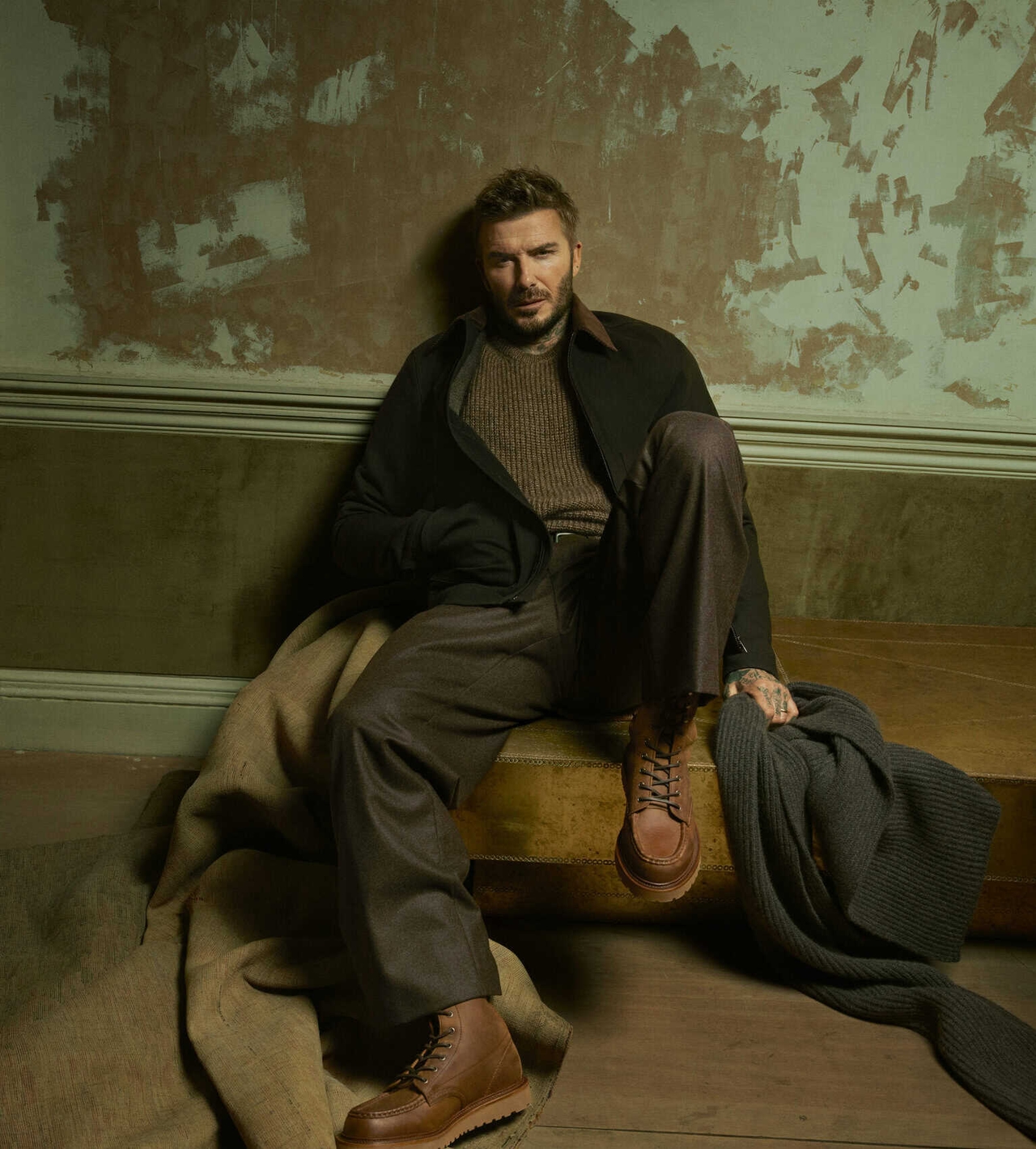Die Strategie der sozialen Wahrnehmung nach Jussi Parikka

Am 22. Juli dieses Jahres geschah in unserem Land etwas noch nie Dagewesenes. An diesem Tag öffneten mehr als 80.000 Menschen – oder sollten wir „Zuschauer“ sagen? – ihre Browser auf YouTube, wo der Nationale Rat für wissenschaftliche und technische Forschung (Conicet) vom Meeresgrund sendete. Mithilfe eines hochentwickelten Kamerasystems sollte die Mission, die in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Schmidt Ocean Institute Foundation durchgeführt wurde, Bilder dieses für das menschliche Auge bisher unzugänglichen Raums zeigen.
Wie durch eine Laune des Schicksals oder einen unfreiwilligen Marketing-Stunt hatte der Verlag Caja Negra einige Zeit zuvor ein Buch veröffentlicht, das wie eigens für diesen Anlass geschrieben schien. „Operational Images“ des Isländers Jussi Parikka mit dem Untertitel „Von der visuellen Darstellung zur Berechnung und Automatisierung“ und Teil der Near Futures -Sammlung schlägt als allgemeine Richtlinie vor, die Auswirkungen der Bildproduktion auf medienorientierte Zielgruppen zu erklären.
Der Autor übernimmt den Begriff vom deutschen Filmemacher Harum Farocki (der ihn bei der Analyse der künstlichen, monochromen Bilder verwendete, die die Angriffe während des Golfkriegs in Echtzeit zeigten – darstellten), um vier grundlegende Fragen zu stellen: Durch welche Elemente (natürliche und künstliche) werden zeitgenössische Bilder gestaltet? Was nehmen wir wahr, wenn wir etwas sehen? Welche Elemente werden sichtbar und welche verborgen? Welche kollektiven Auswirkungen hat diese Wahrnehmung? Kurz gesagt: Operabilität besteht aus der Verbindung zwischen der Fähigkeit zur sozialen Wahrnehmung und ihren Folgen im Laufe der Zeit, die immer historischer und sozialer Natur sind.
Aus dieser Perspektive wurde der Meeresboden zu etwas viel Tieferem als er selbst. Von der ersten Minute der Sendung an wurde klar, dass die Tauchmission nur die Spitze des Eisbergs eines weniger technischen und viel sozialeren Phänomens war. Unterwasser-Streaming basierte auf drei Säulen: der Spannung, die durch die Vorstellung erzeugt wurde, dass in Echtzeit alles erscheinen könnte; der Entdeckung von Meereslebewesen, die nur durch ausgeklügelte Unterwasserartefakte sichtbar gemacht wurden; und der Beobachtung als kollektives Erlebnis. Parikka bezeichnet den ersten Aspekt als unsichtbar, den zweiten als operativ und den dritten als historisch. Doch weit entfernt von einer schematischen Sichtweise interagiert jedes Konzept mit dem anderen in einem offensichtlichen Spiel gegenseitiger Ansteckung.
So zoomt das Buch in den fünf Kapiteln (plus Einleitung und Schluss) wie mit verschiedenen Linsen hinein und heraus, um die Bilder zu vergrößern und zu verkleinern. So befassen sich die ersten Seiten mit der Funktionsweise der Server, auf denen die Grafiken und Diagramme programmiert werden. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf künstliche Intelligenz und beschäftigt sich mit der Schulung von Maschinen und Menschen, die sich mit der Erkennung von Mustern und Formen befassen.
Etwas weiter entfernt sich die Linse, um den Globus aus zwei Perspektiven zu betrachten: aus der Perspektive der Artefakte, die seine „Darstellung“ aus dem Weltraum ermöglichen – und aus der Perspektive der Darstellung, beispielsweise des Globus. In diesem Abschnitt betont Parikka Karten als verzerrendes Instrument. Hier wird deutlich, dass die Karte zwar nicht das Territorium darstellt, diese ungenaue und flache Darstellung jedoch zur Konstruktion einer gemeinsamen sozialen Bedeutung beiträgt. Die Karte ist eindeutig die Akzeptanz einer Konvention.
Dieser Gedanke lässt sich im Kapitel „Fictional Imagery Brought to the Screen“ neu beleuchten. Es verbindet die Tradition des Science-Fiction-Kinos und des Dokumentarfilms, um die mit mentalen Strukturen verbundenen Wahrnehmungsweisen neu zu überdenken. Hier greift er einige weltraumgestützte Übertragungsprojekte auf, die mit aktuellem Streaming in Verbindung gebracht werden könnten. In diesem Kapitel zitiert Parikka den Literaturkritiker Fredric Jameson mit der Frage: „Welche Möglichkeiten gibt es, die Maßstäbe und Abstraktionen des Kapitals in Bezug auf die Welten gelebter Erfahrung abzubilden? Mit anderen Worten: Welche Traditionen, Erinnerungen und kollektiven Kenntnisse wirken im Moment des Sehens (oder Nichtsehens)?“ Diese Frage, die auf den letzten Seiten aufgegriffen wird, bleibt, wenn auch unterschwellig, im Abschnitt über die Stadt bestehen.
Der Autor formuliert es so: Die Vorherrschaft von Fortbewegung, Navigation, Orientierung und Klicks wird in der Stadt durch eine Vielzahl lesbarer und ausführbarer Schnittstellen deutlich. Die Tatsache, dass konkrete Fortbewegungsaktionen mit virtuellen (Navigieren, Klicken usw.) verknüpft sind, ist der deutlichste Beweis dafür, dass das Wahrnehmungssystem Operationen auf anderen Ebenen nutzt und akzeptiert. Schließlich ist GPS nichts anderes als der ständige Dialog zwischen einer realen Oberfläche und ihrer Karte. Das Auto fährt gleichzeitig auf der realen und der virtuellen Autobahn.
Die Unterwasserexpedition endete am 10. August. Das Publikum wurde mit Dankesbotschaften und einem auf dem Meeresboden platzierten Schild mit der Aufschrift „Danke für Ihre Unterstützung“ sowie den Logos der Institutionen, die die Veranstaltung ermöglicht hatten, verabschiedet. Die virtuellen Matrosen feierten und gratulierten den Verantwortlichen mit herzlichen Botschaften, die am Rand des Bildschirms zu lesen waren. Das Streaming-Modell zeigte, dass es trotz seiner Mängel und Kritikpunkte auch ein gemeinsames Erlebnis sein kann, das, während es das Sichtbare zeigt, unmögliche Kreaturen, beispiellose Formen und unzugängliche Welten enthüllt, die sich der Gesellschaft dennoch als Versprechen eines Universums der vielfältigen Sinne präsentieren. Vielleicht besteht die Herausforderung unserer Zeit darin, technische Umgebungen zu schaffen, die zur Entwicklung der menschlichen Wahrnehmung beitragen, ohne Fragen im Zusammenhang mit Erinnerung, Geschichte und Traditionen aus den Augen zu verlieren.
Jussi Parika nimmt an der 4. Ausgabe von „Posthumanía ·4: In(tra)ductions“ teil. Morgen, Sonntag, 21. September, wird er live aus Finnland interviewt. Die Veranstaltung wird von Germán Rúa, Ingrid Sarchman und Margaria Martínez organisiert.
Clarin