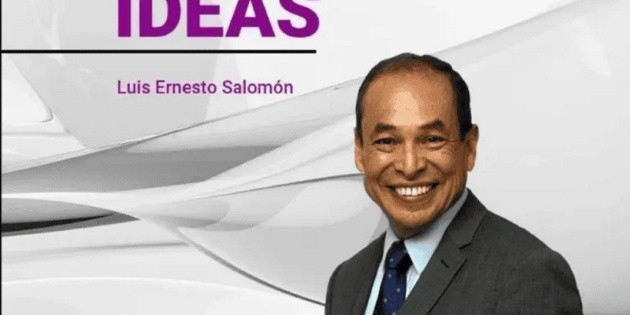KI ist kein Tanzstern
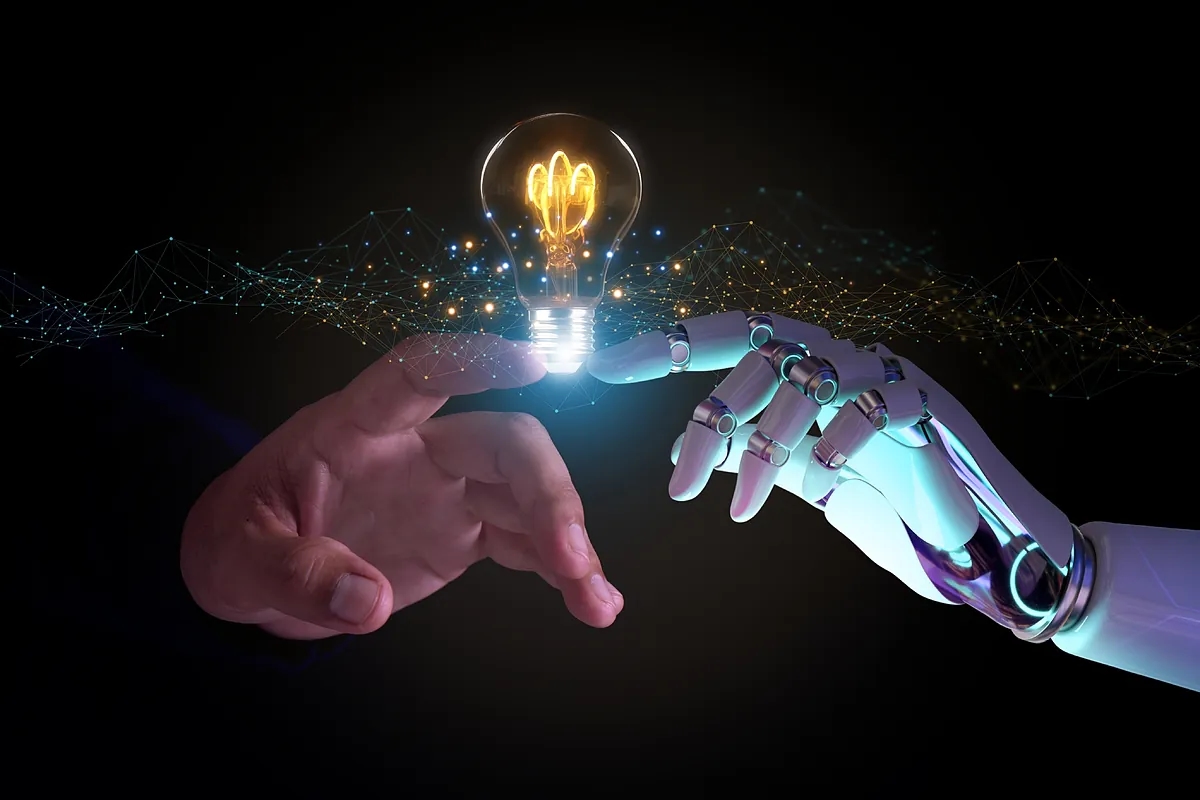
Die Vorstellung, dass alles Schaffen Zerstörung erfordert, ist seit Jahrhunderten Teil unserer kollektiven Vorstellungskraft. Wir haben diese Überzeugung geerbt: dass man leiden muss, um zu lieben; dass man zerstören muss, um zu erfinden; dass das Leben selbst sich von rituellen Opfern nährt. Nietzsche sprach vom Chaos, das notwendig sei, um tanzende Sterne hervorzubringen. Heraklit nannte den Krieg „den Vater aller Dinge“. Und doch zeigt das Leben, dass es nicht immer notwendig ist zu zerstören, um zu erfinden. Es gibt Schöpfungen, die aus Kontinuität entstehen, und Lieben, die ohne Zerstörung bestehen. Es gibt Schöpfungen, die nicht aus Ruinen, sondern aus Geduld geboren werden. Zerstörung ist keine hinreichende Bedingung für Schöpfung, noch rechtfertigt Schönheit Zerstörung. Doch genau dieser Verdacht schwebt heute über der Debatte um künstliche Intelligenz: Was, wenn wir einer Macht gegenüberstünden, die zerstört, ohne zu erschaffen, die imitiert, ohne sich etwas vorzustellen?
Diese Frage beschäftigt nicht länger nur Dichter und Philosophen, sondern auch Ökonomen. Peter Howitt, der Nobelpreisträger von 2025, warnte davor, dass KI ein enormes Potenzial birgt, qualifizierte Arbeitsplätze zu vernichten oder zu ersetzen. Philippe Aghion, sein Nobelpreiskollege, mahnte, dass technologische Führungsrolle heute der Schlüssel zur wirtschaftlichen Macht sei. Dies sind die Worte jener, die ihr Leben der Erforschung von Innovationen gewidmet haben und die gerade angesichts dieser großen Anerkennung auf die Fragilität der Gegenwart hinweisen.
Die Beweislage untermauert ihre Besorgnis. Daron Acemoglu und Pascual Restrepo zeigten in Econometrica (2022), dass KI-basierte Automatisierung nicht nur Routineaufgaben verdrängt, sondern auch Berufe im mittleren und oberen Management betrifft. Eine Studie von OpenAI und der University of Pennsylvania (2023) schätzte, dass 80 % der US-amerikanischen Arbeitskräfte mindestens 10 % ihrer Aufgaben der Automatisierung ausgesetzt sehen und dass fast 20 % mit Veränderungen in mehr als der Hälfte ihrer Arbeit rechnen müssen. Die OECD ergänzte in ihrem Beschäftigungsausblick 2023, dass die am stärksten gefährdeten Sektoren genau jene sind, die anderen technologischen Revolutionen standgehalten haben: Verwaltung, Finanzen und professionelle Dienstleistungen.
Empirische Experimente bestätigen dies. Shaked Noy und Whitney Zhang zeigten in Science (2023), dass Freelancer mit Zugang zu ChatGPT ihre Projekte 40 % schneller und in 18 % höherer Qualität abschlossen. Ein deutlicher Produktivitätszuwachs, aber auch eine Kluft: Wer das Tool nicht nutzte, blieb automatisch auf der Strecke. KI steigert nicht nur die Effizienz, sondern konzentriert den Wert auch in den Händen derjenigen, die sie schnell adaptieren.
Das sind die bisherigen Diagnosen. Um die Neuartigkeit des Augenblicks zu verstehen, ist ein Blick zurück hilfreich. In der Industriellen Revolution vernichtete die Dampfmaschine zwar das Handwerk, schuf aber gleichzeitig die Eisenbahn, die Stahlindustrie und die moderne Logistik. Mit der Elektrifizierung des 19. Jahrhunderts verschwanden Millionen von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft, doch entstanden die Chemie-, Konsumgüter- und Dienstleistungsindustrie. Ende des 20. Jahrhunderts beseitigten Computer und später das Internet Büro- und Schreibkräftejobs, eröffneten aber gleichzeitig neue Möglichkeiten in den Bereichen Telekommunikation, Software, Biotechnologie und digitale Plattformen. In jeder dieser Wellen ging der Zerstörung ein sichtbarer Horizont des Neuen voraus.
Bei künstlicher Intelligenz ist diese Symmetrie unklar. Wir wissen, was verloren geht – kognitive Aufgaben, Berichtswesen, Datenklassifizierung, repetitive Analysen –, aber wir wissen noch nicht, was an seine Stelle tritt. Es gibt keinen aufstrebenden Sektor, der dem Eisenbahnwesen oder dem Internet gleichkäme. Was wir momentan haben, ist Effizienz. Und Effizienz allein hat noch nie ausgereicht, um Gesellschaften zu erhalten.
Hierin liegt das Gespenst der „unkreativen Zerstörung“: ein Szenario, in dem KI bestehende Bereiche ersetzt, ohne neue zu erschließen. Dieses Gespenst wirkt umso bedrohlicher, da KI – entgegen ihrem Namen – nicht erfindet. Ihre Stärke liegt in der Vorhersage, nicht im Eingehen von Risiken. Sie kann ein Gedicht schreiben oder einen Rechtsfall mithilfe von Daten lösen, aber sie gründet keine Kunstrichtung und definiert das Recht nicht neu. Sie imitiert elegant, aber sie begründet keine neuen.
Sind wir also zu Verderben ohne Wiedergeburt verdammt? Nicht unbedingt. Es gibt Hoffnungsschimmer, die nicht in der Maschine, sondern in uns liegen. Im Berufsleben ersetzt KI Aufgaben, nicht ganze Identitäten. Die Menschheit bewahrt ihre Stärke im Urteilsvermögen, im Einfühlungsvermögen, in der Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen. In einer Welt voller makelloser Berichte wird das, was uns bewegt, knapp werden. Der Markt wird letztendlich das schätzen, was ein Algorithmus nicht hervorbringen kann: echte Überraschung, unerwartete Nuancen, die eigene Stimme.
Im politischen Bereich, wie Acemoglu selbst betont, hängt das makroökonomische Ergebnis davon ab, wie wir Anreize setzen. Beschränken sich diese auf Lohnsenkungen, wird das Wachstum ungleichmäßig und gering ausfallen. Werden sie hingegen auf den Ausbau von Kompetenzen – in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und Energiewende – ausgerichtet, ist der Multiplikatoreffekt größer und gerechter. Innovation ist kein Ziel, sondern eine institutionelle Entscheidung.
Und die größte Hoffnung liegt vielleicht in der kulturellen Dimension. KI kann Formen imitieren, aber sie vermittelt keine Bedeutung. Je komplexer und undurchsichtiger die Modelle sind, desto größer ist der Bedarf an Vertrauen: Wer überprüft, wer interpretiert, wer sichert die Gültigkeit der Ergebnisse? Die Zukunft könnte sich um diese Validierungsökonomie drehen, in der der Wert nicht in Informationen, sondern in Glaubwürdigkeit liegt.
Doch es gibt eine tiefere Ebene. Künstliche Intelligenz liebt nicht. Sie kennt weder Zärtlichkeit noch schöpferische Beharrlichkeit noch die Hingabe, die Kunst und Wissenschaft erst möglich macht. Darin liegt der grundlegende Unterschied: Menschen erschaffen nicht nur aus Berechnungen, sondern aus Sehnsucht, aus der Vorstellungskraft für das, was noch nicht existiert. Hoffnung ist daher keine technologische, sondern eine anthropologische Geste. Während KI das Vorhandene reproduziert, bleiben wir fähig, das Unerwartete zu erfinden und das zu bewahren, was wir lieben.
Die diesjährigen Nobelpreise verkündeten keine Apokalypse, sondern eine Warnung: Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jede Zerstörung schöpferisch sein wird. Die Geschichte garantiert nicht mehr, dass nach jeder neuen Maschine ein neuer Beruf entsteht. Was sie aber garantiert, ist, dass Effizienz ohne kollektive Entscheidungsfindung Sinn verdrängen kann. Die Gefahr ist real: dass Algorithmen zu einer eleganten und billigen Ersatzmaschine werden, die unfähig ist, die Zukunft zu erhellen. Die Chance ist ebenso real: dass wir sie als Unterstützung unserer Fähigkeiten, als Hilfe für unsere Vorstellungskraft und nicht als Abkürzung in die Arbeitslosigkeit nutzen.
Fortschritt bedeutet nicht, Zerstörung zu beschleunigen, sondern Raum zu schaffen, in dem Schöpfung und Liebe sich vereinen, nicht der Verderb. Solange diese Möglichkeit besteht, wird uns der tanzende Stern erhalten bleiben. Zeit, mehr als Feuer, war schon immer der größte Verbündete der Erfindung: Was langsam reift, hält tendenziell länger als das, was aus Trümmern emporwächst.
*Francisco Rodríguez ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Granada und Direktor des Bereichs Finanzen und Digitalisierung bei Funcas.
elmundo